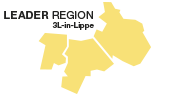Studie „Jugendkultur/Junge Kultur“
Kulturelle Teilhabe junger Menschen: Bedürfnisse, Potenziale und Angebote
Für eine positive Stadtentwicklung ist die Identifikation jugendlicher Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Lebensort bzw. ihrer Lebensregion von großer Bedeutung. Eine entscheidende Rolle spielt dabei ein kulturelles Angebot, das den Bedürfnissen der jungen Generation entspricht.
Da das Verständnis des Kulturbegriffs in den Generationen sehr unterschiedlich ausfallen kann, haben die Alte Hansestadt Lemgo, die Stadt Lage und die Gemeinde Leopoldshöhe sich zum Ziel gesetzt, die Bedarfe von Jugendlichen im Alter von 10 bis 26 Jahren zu ermitteln. Dieses Wissen soll eine inhaltliche Grundlage darstellen, um das Einbringen und Umsetzen ihrer Interessen hinsichtlich kultureller Angebote zu erleichtern.
Für die beteiligten Kommunen sind verschiedene Altersgruppen von besonderem Interesse. Denn aus den Erfahrungen in der Praxis ist die Erreichbarkeit der 10 bis 13-Jährigen über kulturelle Angebote sehr gut möglich. Für die darüber hinaus gehenden Altersklassen bestehen hinsichtlich der Erreichbarkeit größere Herausforderungen. Daher soll eine professionell erstellte Studie nutzbare Ergebnisse liefern, die in der Herangehensweise altersgemäß differenziert, dabei vielfältige sozial-empirische wie auch kreative Methoden für eine erfolgreiche Ansprache nutzt und die Freiheit der Jugendlichen, nicht partizipieren zu wollen, miteinschließt.